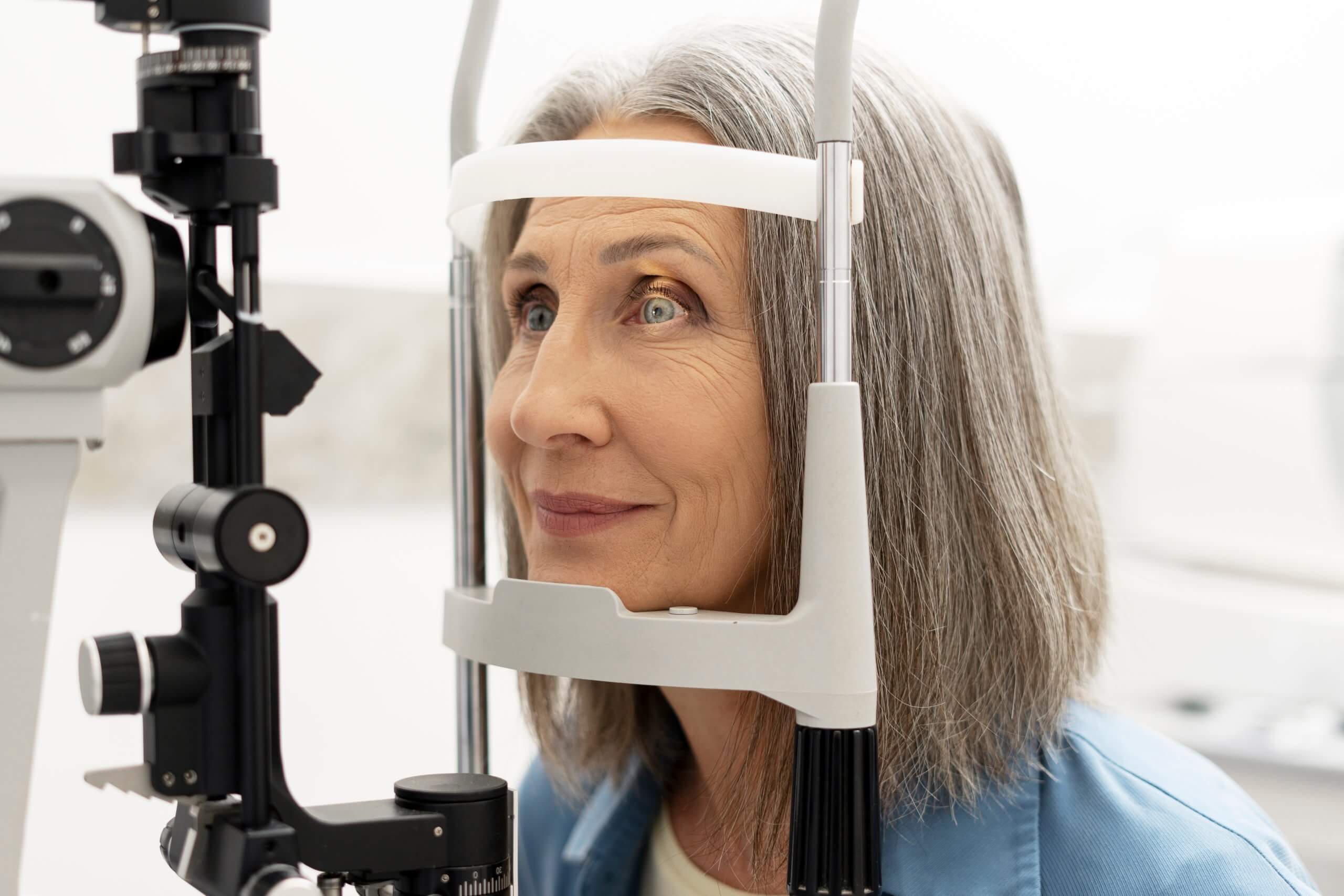Grauer Star und Grüner Star zählen zu den häufigsten Ursachen für eine Sehverschlechterung im Alter. Obwohl ihre Namen ähnlich klingen, unterscheiden sie sich grundlegend – sowohl in der Entstehung als auch im Verlauf und der Behandlung.
In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, was hinter den beiden Begriffen steckt, welche Warnsignale Sie kennen sollten und warum eine augenärztliche Vorsorge so wichtig ist.
Grauer Star und grüner Star: Die wichtigsten Unterschiede
Grauer Star (Katarakt) und Grüner Star (Glaukom) werden häufig miteinander verwechselt. Dabei handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Erkrankungen mit jeweils eigenen Ursachen, Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten. Ein vergleichender Blick auf beide Krankheitsbilder hilft, Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser zu verstehen – und zeigt, warum die richtige Diagnose so entscheidend ist.
| Merkmal | Grauer Star (Katarakt) | Grüner Star (Glaukom) |
| Ursache | Trübung der Augenlinse | Schädigung des Sehnervs durch erhöhten Augeninnendruck |
| Verlauf | Langsam fortschreitend, früh bemerkbar | Oft lange symptomlos, schleichender Verlauf |
| Symptome | Verschwommenes Sehen, Blendempfindlichkeit | Gesichtsfeldausfälle, Schattensehen |
| Behandlung | Operative Entfernung der getrübten Linse und Einsatz einer Kunstlinse | Medikamentöse Behandlung, ggf. Laser oder Operation |
| Prognose | Sehr gute Heilungschancen nach Operation | Irreversibler Sehverlust möglich, wenn unbehandelt |
| Bedeutung der Vorsorge | Wichtig zur Bestimmung des OP-Zeitpunkts | Entscheidend zur Früherkennung und Verhinderung von Sehverlust |
Der Graue Star – häufige Altersveränderung mit guter Prognose
Im fortgeschrittenen Alter zählt der Graue Star (Katarakt) zu den am häufigsten auftretenden Augenerkrankungen.
Die Erkrankung entsteht durch eine Trübung der Augenlinse, die sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Diese Veränderung ist Teil des natürlichen Alterungsprozesses und betrifft in vielen Fällen Menschen ab dem 50. Lebensjahr.
Im Anfangsstadium wird die Linsentrübung oft gar nicht bemerkt. Erst wenn sich die Sehschärfe verschlechtert, das Sehvermögen nachlässt oder Doppelbilder auftreten, wird ein Augenarzt aufgesucht.
Auch eine verstärkte Blendung durch Lichtquellen, Probleme beim Sehen in der Dämmerung oder häufige Änderungen der Brillenstärke bzw. Stärke der Kontaktlinsen können Hinweise auf eine trübe Linse sein.
Typische Anzeichen für den Grauen Star:
- Trübes oder verschwommenes Sehen
- Erhöhte Blendempfindlichkeit, insbesondere bei Nacht
- Verschlechterung der Farbwahrnehmung
- Häufige Änderung der Brillenstärke
Die Ursachen sind vielfältig: Neben dem Alter zählen Diabetes mellitus, trockene Augen, bestimmte Medikamente (z. B. Kortison), aber auch frühere Augenoperationen oder Verletzungen zu den Risikofaktoren. Auch genetische Veranlagung oder eine starke Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit können die Linsentrübung begünstigen.
Der Name „Grauer Star“ leitet sich vom früher beobachteten starren Blick erblindeter Menschen ab. In Zeiten, in denen eine operative Entfernung der trüben Linse noch nicht möglich war, führte der Katarakt häufig zur vollständigen Erblindung.
Anders als viele andere Augenerkrankungen lässt sich der Graue Star heutzutage sehr gut behandeln. Bei dem kurzen, schmerzfreien Eingriff wird die getrübte körpereigene Linse durch eine künstliche Intraokularlinse ersetzt.
Diese moderne Methode der Augenheilkunde gilt als Routineeingriff und dauert meist nur wenige Minuten. Je nach individueller Sehbedürfnisse kommen spezielle Kunstlinsen zum Einsatz, etwa bei gleichzeitiger Hornhautverkrümmung.
Der Grüne Star – heimtückisch und lange unbemerkt
Der Grüne Star, auch Glaukom genannt, bezeichnet eine Gruppe von Augenerkrankungen, bei denen der Sehnerv dauerhaft geschädigt wird. Ein erhöhter Augeninnendruck gilt als bedeutender Risikofaktor, ist jedoch nicht in allen Fällen die Ursache. Dieser entsteht, wenn das im Augeninneren gebildete Kammerwasser nicht mehr korrekt abfließt. Ein gestörter Abfluss des Kammerwassers kann zu einer Drucksteigerung führen, die den empfindlichen Sehnerv schädigt.
Der Grüne Star tritt in verschiedenen Formen auf, die sich nach Ursache, anatomischem Aufbau und Krankheitsverlauf unterscheiden. Ein kompakter Überblick:
Nach Ursache:
- Primäres Glaukom: Ohne erkennbare Grunderkrankung, oft genetisch bedingt.
- Sekundäres Glaukom: Folge anderer Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Uveitis oder Kortisontherapie.
Nach Anatomie:
- Offenwinkelglaukom: Häufigste Form, schleichender Verlauf bei offenem Kammerwinkel.
- Engwinkelglaukom: Kammerwinkel blockiert, Gefahr eines akuten Druckanstiegs (Glaukomanfall).
Nach Verlauf:
- Akutes Glaukom: Plötzlicher starker Anstieg des Augeninnendrucks, Notfall.
- Normaldruckglaukom: Sehnervschädigung trotz normalem Druck, meist durch Durchblutungsstörungen.
Nach Lebensalter:
- Angeborenes Glaukom: Sehr selten, tritt im Säuglings- oder Kleinkindalter auf.
- Altersbedingtes Glaukom (Altersglaukom): Tritt meist ab dem 40. Lebensjahr auf, Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Meist handelt es sich um ein primäres Offenwinkelglaukom.
Sonderformen:
- Pigmentdispersionsglaukom: Pigmente aus der Iris verstopfen das Abflusssystem.
- Pseudoexfoliationsglaukom: Eiweißablagerungen beeinträchtigen den Abfluss des Kammerwassers und erhöhen den Druck.
Typische Anzeichen für den Grünen Star:
- Langsame, schmerzlose Verschlechterung des Sehvermögens
- Einschränkungen im äußeren Gesichtsfeld (Tunnelblick)
- Gesichtsfeldausfälle
- Wahrnehmung von Schatten oder dunklen Flecken im Sichtfeld
- Häufige Kopfschmerzen oder Druckgefühl um das Auge
- Plötzliche starke Augenschmerzen und Übelkeit bei einem Glaukomanfall
Die Herausforderung bei dieser Erkrankung: Gerade in der chronischen Verlaufsform verläuft das Glaukom zunächst symptomfrei. Schäden am Sehnerv bleiben daher oft unbemerkt, bis sie bereits weit fortgeschritten sind.
Ein unbehandeltes Glaukom kann zur Erblindung führen. Der akute Glaukomanfall ist eine seltene, aber besonders gefährliche Form. Hier steigt der Augendruck innerhalb kürzester Zeit massiv an. In diesen seltenen Fällen droht ohne sofortige Behandlung ein dauerhafter Verlust der Sehfähigkeit.
Der Begriff „Grüner Star“ geht möglicherweise auf eine grünlich wirkende Verfärbung der Pupille im fortgeschrittenen Krankheitsstadium zurück, wie sie durch Lichtreflexe bei Hornhauttrübung entstehen kann.
Die Behandlung eines Glaukoms erfolgt meist medikamentös – mit Augentropfen, die den hohen Augeninnendruck senken. Je nach Verlauf kann zusätzlich eine Laserbehandlung oder eine mikrochirurgische Operation notwendig sein. Ziel ist es, die Schädigung des Sehnervs zu stoppen und das vorhandene Sehvermögen zu erhalten.
Warum Vorsorgeuntersuchungen so wichtig sind
Da der Grüne Star (Glaukom) zu Beginn meist keine Beschwerden verursacht, kommt der frühzeitigen Erkennung eine zentrale Bedeutung zu. Besonders ab dem 40. Lebensjahr sind regelmäßige augenärztliche Vorsorgeuntersuchungen ratsam – insbesondere bei Risikofaktoren wie familiärer Vorbelastung, Diabetes mellitus, Bluthochdruck, ausgeprägter Kurzsichtigkeit oder früheren Augenverletzungen. Auch Personen mit trockenen Augen oder langfristiger Kortisontherapie sollten ihr Risiko überprüfen lassen.
Empfohlene Untersuchungen zur Früherkennung:
- Messung des Augeninnendrucks
- Beurteilung des Sehnervs (Papille)
- Gesichtsfelduntersuchung (Perimetrie)
- Netzhaut-Scan (OCT)
- Pachymetrie (Hornhautdickenmessung)
Auch beim Grauen Star ist die augenärztliche Kontrolle wichtig, da die Linsentrübung oft zunimmt, ohne dass es zunächst zu gravierenden Einschränkungen kommt. Eine frühe Diagnose erhöht die Chance auf einen optimalen Zeitpunkt für eine Operation und sichert langfristig das Sehvermögen.
Lebensqualität und Sehverlust – unterschätzte Auswirkungen
Sowohl der Graue Star als auch der Grüne Star beeinträchtigen nicht nur das Sehvermögen, sondern auch die Lebensqualität. Sehstörungen wie zum Beispiel Einschränkungen beim Lesen, Autofahren oder Erkennen von Gesichtern können soziale Isolation oder Unsicherheit im Alltag zur Folge haben. Vor allem beim Grünen Star droht bei fehlender Behandlung ein schleichender Rückzug aus dem aktiven Leben.
Eine rechtzeitige und gezielte Therapie hilft, diese Folgen zu vermeiden. Wichtig ist, Symptome ernst zu nehmen und augenärztliche Empfehlungen konsequent umzusetzen.
Moderne Diagnostik und individuelle Betreuung im AugenCentrum am Rothenbaum
Im AugenCentrum am Rothenbaum profitieren Sie von umfassender Diagnostik und individuellen Behandlungsmöglichkeiten für Grauen Star und Grünen Star. Ein erfahrenes Team, moderne Geräte und sorgfältige Untersuchungen bilden die Grundlage unserer patientenorientierten Arbeit. Bei uns werden Sie nicht nur untersucht, sondern durchgehend von unseren Augenspezialisten Priv.-Doz. Dr. med. Johannes Gonnermann und Priv.-Doz. Dr. med. Tim Schultz begleitet, die gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Augengesundheit finden.
Ob frühzeitige Diagnostik, augenschonende Laserbehandlung oder Linsenimplantation – wir beraten Sie individuell und auf Augenhöhe. Als inhabergeführtes Zentrum setzen wir bewusst auf Qualität statt Standardlösungen von Drittanbietern. Ihre Sehkraft ist bei uns in guten und erfahrenen Händen.